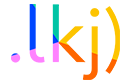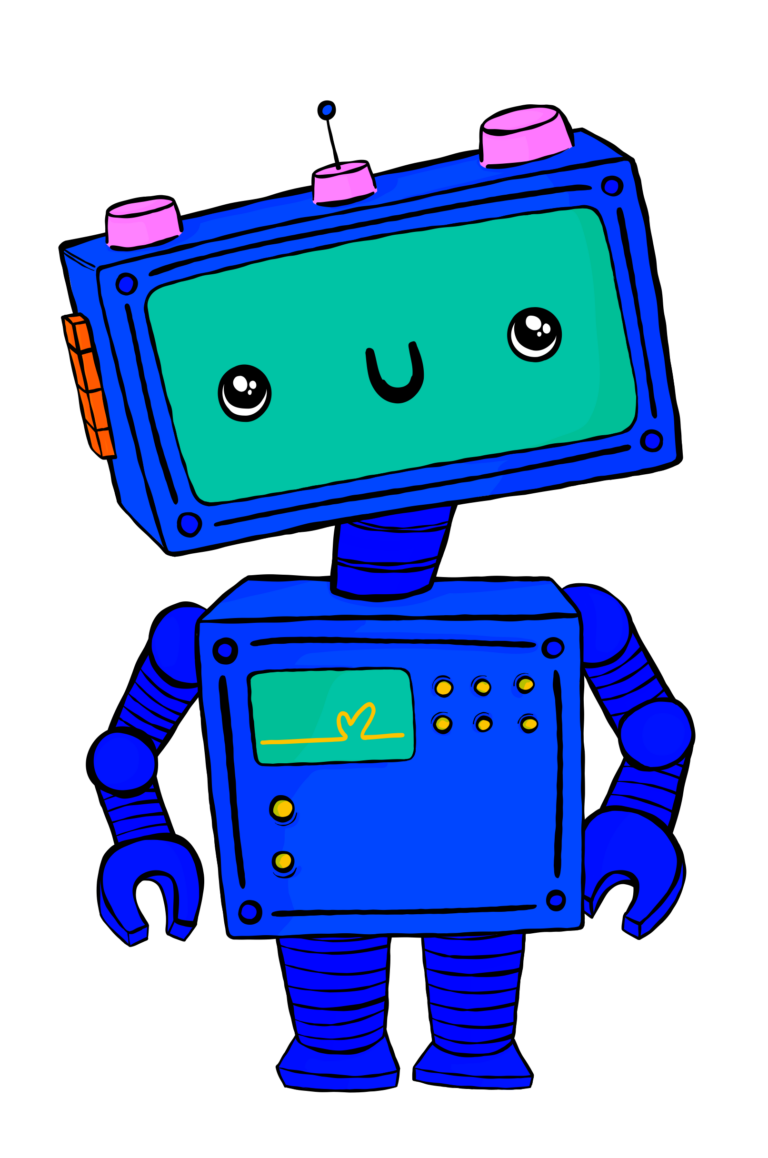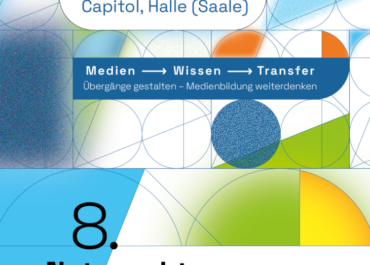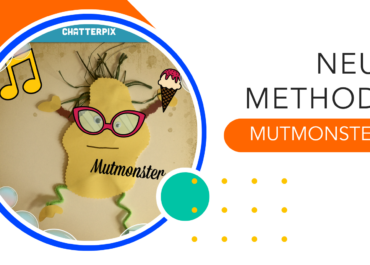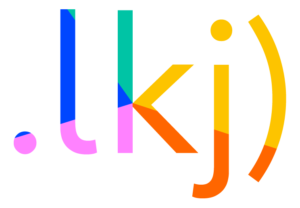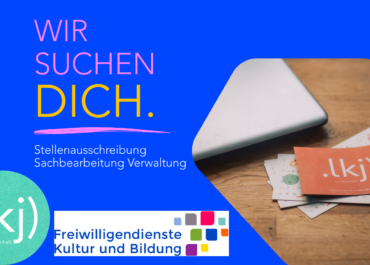Servicestelle für digitale Kulturelle Bildung
Warum digitale Kulturelle Bildung?
Kinder und Jugendliche nutzen digitale Medien in ihrem Alltag ganz selbstverständlich. Dabei entstehen viele kreative Ausdrucksformen: selbst erstellte Videos, digitale Musikproduktionen, mit Software bearbeitete Bilder etc.
Dabei experimentieren sie, werden kreativ und sammeln neue Erfahrungen – ganz von selbst, ohne das Zutun von Erwachsenen.
Und hier setzt digitale Kulturelle Bildung an: Es geht darum, diese vorhandenen künstlerischen Prozesse aufzunehmen und mit sinnvollen Angeboten zu begleiten. Digitale Methoden ermöglichen Einrichtungen aus Kultur und Bildung, neue Angebotsformate zu schaffen und damit Kinder und Jugendliche noch besser zu erreichen. Dafür braucht es gute Konzepte, erprobte Methoden und Erfahrung.
Die »Servicestelle für digitale kulturelle Bildung« ist eine Anlaufstelle für alle, die im Bereich der digitalen Kulturellen Bildung tätig sind – oder tätig werden wollen. Sie ist einerseits eine Plattform zum Austausch und zur Fortbildung von Kulturakteur*innen in Sachsen-Anhalt. Andererseits werden neue Methoden entwickelt, getestet und zur Verfügung gestellt. Es entsteht eine Mediathek an erprobten Methoden der digitalen Kulturellen Bildung, die für alle kostenfrei zugänglich ist.
Das bieten wir:
- Jugendgerechte Kulturelle Bildung in der digitalen Gesellschaft
- Entwickeln und Erproben von Methoden
- Plattform zum Austausch und zur Fortbildung von Kulturakteur*innen in Sachsen-Anhalt
Das möchten wir:
Kulturakteur*innen stehen – spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie – vor der Herausforderung, analoge Formate digital zu denken, um Kinder und Jugendliche weiterhin zu erreichen. Wir möchten die Digitalisierung der Kulturellen Bildung professionell begleiten und bei der Entwicklung und Erprobung neuer Methoden und Tools unterstützen: kreativ, kritisch-konstruktiv und immer mit Blick auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen. Das ist umso wichtiger, weil Digitalisierung ohnehin stattfindet und einen erheblichen Einfluss auf all unsere Lebensbereiche hat.
Die »Servicestelle für digitale kulturelle Bildung« versteht sich als Treffpunkt und Anlaufstelle für Kulturakteur*innen. Wir ermöglichen den Austausch der Beteiligten miteinander:
Wir veranstalten Netzwerktreffen und bieten Fortbildungen zu Themen der digitalen Kulturellen Bildung durch Expert*innen an. Zudem entwickeln wir gemeinsam mit Kulturakteur*innen praktische Methoden, bspw. in den Bereichen Foto, Film, Audio, Kunst, Apps und Spiele sowie Coding und KI. Die Methoden werden mit Kindern und Jugendlichen erprobt, didaktisch aufbereitet und Akteur*innen der Kulturellen Bildung in Form einer Mediathek zur Verfügung gestellt.
Smartphone, Computer, Apps und digitale Medien gehören ganz selbstverständlich zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Viele künstlerische Ausdrucksformen entstehen dabei bereits beim Benutzen von digitalen Medien, auch ohne dass Erwachsene dabei sind. An dieser Stelle ist es die Aufgabe von Kultureller Bildung, nicht nur analoge, sondern auch zeitgemäße digitale Angebote zu schaffen, die die Erfahrungen, Interessen und Lebenswirklichkeit junger Menschen berücksichtigt und einbezieht. Dafür setzt sich die »Servicestelle für digitale kulturelle Bildung« ein.
Übergeordnetes Ziel der »Servicestelle für digitale kulturelle Bildung« ist es, dass alle Kinder und Jugendlichen an Kunst und Kultur teilhaben können, wenn sie es möchten. Eine große Stärke von Digitalisierung ist, dass sie Menschen neue Zugänge ermöglicht: Digitale Tools wie z. B. Videokonferenzen erleichtern bspw. Menschen mit körperlichen Einschränkungen die gesellschaftliche Teilhabe, weil sie von zuhause aus mitmachen können, wenn Angebote vor Ort nicht barrierefrei sind. Digitale Kulturelle Bildung bietet zudem viele Möglichkeiten, damit Menschen aller Altersgruppen sinnliche Erfahrungen mit Kunst und Kultur sammeln können und sie damit letztlich an Bildungsprozessen teilhaben können.
Kulturelle Bildung, ob analog oder digital, ermöglicht es jungen Menschen, sich als wertvollen Teil einer Gruppe zu erleben und Selbstwirksamkeit wahrzunehmen. Besonders, wenn Kinder und Jugendliche sozial benachteiligt sind, Ausgrenzung oder Rassismus erfahren, trägt digitale Mündigkeit zusätzlich zu Empowerment bei. Digitale Mündigkeit heißt einerseits, technisch versiert mit Tools, Apps und Software umgehen zu können. Vor allem bedeutet es aber, dass Kinder und Jugendliche dann auch in der Lage sind, digitale Mechanismen und Prozesse wie Hass und Hetze im Netz zu verstehen und sich besser vor ihnen zu schützen. All das trägt auch dazu bei, dass sich Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt zurechtfinden.

Zielgruppe
Multiplikator*innen, Kulturpädagog*innen, Vereine, Verbände, kommunale Einrichtungen und andere Interessierte aus Sachsen-Anhalt

Standorte
Wir arbeiten aus der Geschäftsstelle in Magdeburg für und in Sachsen-Anhalt.
Die »Servicestelle digitale Kulturelle Bildung« ist ein Programm der .lkj) Sachsen-Anhalt und wurde gefördert von Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt.
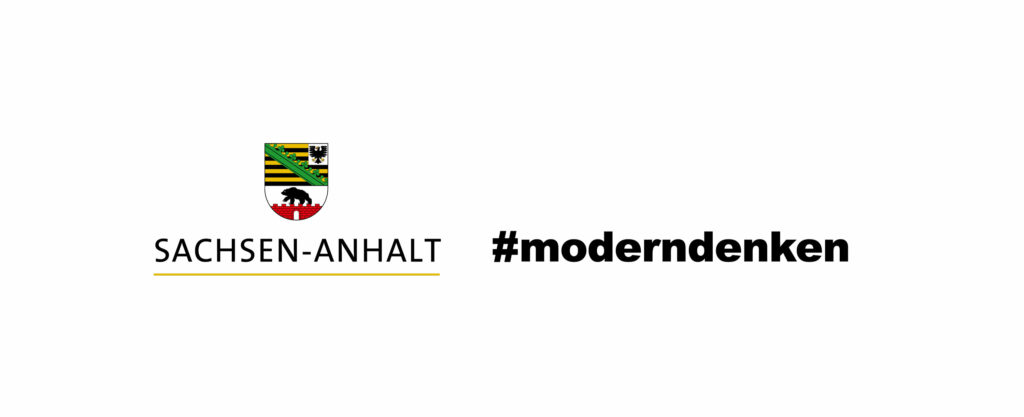
Kontakt Deine Ansprechpersonen:

Aktuelles aus dem Projekt
8. Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt!
Die Veranstaltung fand im Capitol Halle (Saale) statt, einem ehemaligen Kino aus den 1920er Jahren, das heute als Veranstaltungsort genutzt wird. Nach einer kurzen Begrüßung eröffnete Dr. Oliver Nahm vom Bundesinstitut für Berufsbildung den Tag mit einem inspirierenden Impulsvortrag über Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz. Die Themen reichten von praktischen Alltagsfragen bis hin zu globalen Entwicklungen. Mit einer unterhaltsamen Mischung aus Memes, apokalyptischen Szenarien und Zukunftsvisionen gelang es, einen umfassenden Überblick über aktuelle Trends zu geben und die Teilnehmenden auf den weiteren Verlauf einzustimmen. Der begeisterte Applaus im Anschluss sprach für sich!
Im Anschluss diskutierten Vertreter*innen verschiedener Ministerien sowie weitere Partner*innen in einer Podiumsdiskussion darüber, inwiefern Medienbildung eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe ist und wie Kooperationen verbessert werden können. Ein eher trockenes Thema, aber dennoch sehr aufschlussreich.Nach der Mittagspause im Foyer folgte der praktische Teil. Im Workshop „Medien.Bildung.Kooperativ reloaded“ wurden die Teilnehmenden unter Anleitung eines KI-Chatbots durch mehrere Stationen in Kleingruppen geführt. Dazu gehörten das Drehen eines Stop-Motion-Erklärvideos, die Nutzung von KI per Megaprompt für komplexe Aufgaben sowie das digitale Design und Bedrucken einer Tasche.
Ein herzliches Dankeschön an alle Referent*innen, Workshop-Leitenden und Teilnehmenden für die inspirierenden Begegnungen!
Text: Jonas Blau
Open Brush: Virtuelle Realität als ästhetischer Erfahrungsraum
Ein Pinselstrich, der sich durch die Luft zieht, ein Kreis aus Licht, der den eigenen Körper umschließt – und plötzlich steht man mitten im Bild. Wer Open Brush nutzt, malt nicht auf einer Fläche, sondern im Raum. Das wirkt zunächst wie ein Spiel, entpuppt sich aber als intensiver künstlerischer Prozess: Sehen, Fühlen und Gestalten verschmelzen zu einer unmittelbaren Erfahrung.
Die neue Methode Räume erobern mit Open Brush der Servicestelle für digitale Kulturelle Bildung lädt dazu ein, utopisch zu denken und Visionen für kinder- und jugendgerechte Orte zu entwerfen. Beim Fachtag „Vernetzen, Verändern, Gestalten – Kulturelle Bildung trifft Soziale Arbeit“ der Franckeschen Stiftungen in Halle wurde die Methode mit Fachkräften praktisch erprobt. Ziel war es, digitale Werkzeuge als Mittel ästhetischer Bildung zu untersuchen – jenseits von Effekten oder Technikfaszination. Open Brush ist eine frei verfügbare Open-Source-Anwendung, die auf Googles Tilt Brush aufbaut. Mit VR-Brille und Controllern lassen sich Linien, Flächen und Lichtspuren dreidimensional in den Raum zeichnen.
Die ersten Minuten gehörten dem Staunen. Danach begann die eigentliche Arbeit: Wie wollen wir Räume gestalten, in denen wir uns bewegen – physisch, sozial, symbolisch? Was bedeutet es, Raum zu teilen, ihn mit anderen auszuhandeln? Wie würde ein Ort aussehen, an dem du dich entspannen, kreativ entfalten, lernen, bewegen oder einfach mit anderen zusammen sein kannst?
Die Methode setzt bewusst auf Aufgaben, die Haltung erfordern: einen Raum der Geborgenheit entwerfen, einen Wohlfühlort gestalten, eine Stimmung begehbar machen. In diesen Momenten entsteht der Übergang vom digitalen Experiment zum künstlerischen Denken. Open Brush erweitert ästhetische Praxis, weil es Raum als gestaltbares Medium begreifbar macht. Perspektive ist kein abstrakter Begriff, sondern eine körperliche Erfahrung. Wer zeichnet, bewegt sich – und erfährt unmittelbar, dass Wahrnehmung vom Standpunkt abhängt. Damit öffnet sich ein Zugang zu Themen, die in der kulturellen Bildungsarbeit zentral sind: Teilhabe, Ausdruck, Selbstwahrnehmung.
Gerade in der Verbindung von kultureller Bildung und sozialer Arbeit eröffnet das Potenziale. Gerade für junge Menschen, die selten Einfluss auf ihre Umgebung nehmen können, entsteht so ein niedrigschwelliger Zugang zu Mitgestaltung und Ausdruck. Teilnehmende können hier eigene Räume erschaffen – sichtbar und begehbar. Der digitale Raum wird so zum Resonanzraum, in dem Wahrnehmung geschärft und Gestaltung bewusster wird.
Trotz der Begeisterung beim Fachtag blieb Skepsis erlaubt – und notwendig. Die Methode erfordert Technik und Betreuung und eignet sich nicht für jede Gruppe. Manche reagieren empfindlich auf Sinnesreize. Nicht jede Einrichtung kann sich die Anschaffung finanziell leisten. Vielerorts können VR-Brillen jedoch ausgeliehen werden, etwa über Medienzentren oder Bildungsträger.
Unterstützung bietet die Servicestelle für digitale Kulturelle Bildung der .lkj) Sachsen-Anhalt, ein vom Land Sachsen-Anhalt gefördertes Programm. Auf ihrer Methodenseite stellt der Dachverband diese und weitere erprobte Methoden als ausführliche, kostenfrei zugängliche Anleitungen mit Materialien und Praxisbeispielen bereit.